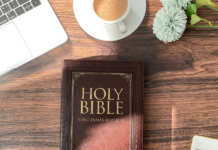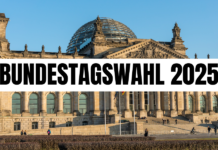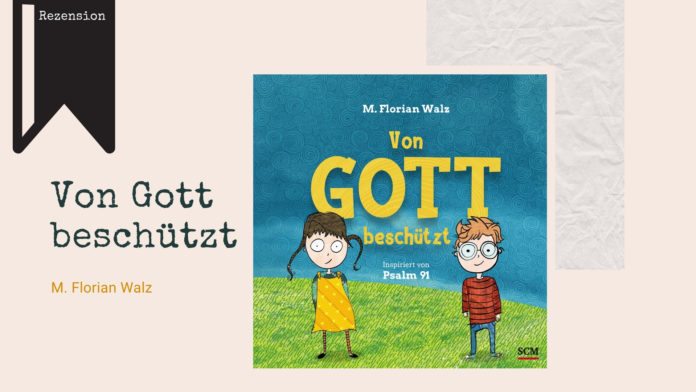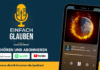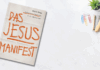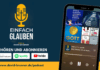Über dieses Thema mache ich mir immer wieder Gedanken – erst neulich, als es um den „Gottesdienst der Zukunft“ ging oder auch im Blick auf die Corona-Pandemie und was wir für die Zukunft daraus lernen können („Corona. Gemeinde. Pastor. Bestandsaufnahme und Ausblick.“ und „5 Dinge, die es auch nach der “Corona-Krise” braucht„). In diesem Artikel geht es aber um mehr – es geht um Kirche als solche.
Hier kommen also 7 laut ausgeschriebene Gedanken, was Kirche zukunftsfähig macht. Bedenke: Das hier ist ein Blog – keine wissenschaftliche Abhandlung.
1Zurück zum wirklichen Auftrag

Bevor wir uns über das WIE und WAS unterhalten, ist eines klar: Kein Mensch braucht eine Kirche, die lediglich die schlechte Kopie einer politischen Partei (egal welcher Art) ist. Der Auftrag von Kirche ist in erster Linie ein ganz simpler und einfacher:
Das sind die letzten Worte Jesu und das ist der Auftrag von Kirche: Menschen, die Gott noch nicht kennen, sollen zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. Dafür gibt es Kirche, dafür existiert sie in tausenden Gemeinden vor Ort: Damit Menschen Jesus Christus erleben, annehmen und ihm nachfolgen.
Keinen anderen Auftrag hinterließ Jesus seinen Jüngern.
Heute jedoch rutschen vielerorts in Kirche Randthemen ins Zentrum. Da geht es mehr um Klimaschutz, den interreligiösen Dialog und Positionierungen zu Genderthemen. Das kann man alles machen, das ist nicht die Frage – aber es nicht der ureigenste Auftrag von Kirche!
Kirche muss sich unbedingt darauf zurückbesinnen, was ihr „U.S.P.“ (unique selling point) ist! Wenn der nicht klar ist, bringen die folgenden Punkte auch nichts. Denn wir sollten uns im Klaren sein: Kirche ist ein „geistliches Geschehen“. Wir Menschen können es nicht „machen“. Dass Glaube entsteht, dass Beziehung zu Jesus gelebt wird, das kann ich (als Pfarrer) nicht „machen“. Ich kann aber eines: Den Weg ebnen, darüber reden, prüfen, ob das, was ich sage, dem Auftrag Jesu entspricht und ob es dem zuträglich ist, dass Menschen in Jesus allein die Wahrheit und die Rettung für ihr Leben erkennen.
Ich glaube, dass Gott nicht segnet, was er nicht gut findet. Ich glaube aber, dass Gott seinen Segen dort ausgießt, wo Menschen dem Missionsauftrag nachkommen und Kirche sich um diesen Missionsauftrag herum gestaltet. Kirche hat keine andere Wahl – dieser Auftrag ist ihr gegeben. Wo sie ihm nicht nachkommt, verlässt sie die Wege ihres „Chefs“ – und nun ja. Wer einen Chef hat, der weiß: Dessen Weg, dessen Vorgaben, dessen Vorstellungen nicht zu beachten oder links liegen zu lassen, ist keine gute Idee. Er ist ja nicht umsonst Chef und weiß, was am besten ist.
Deswegen: Wenn Kirche in Form der örtlichen Gemeinden nicht diesen Missionsauftrag ernst nimmt und ihr gesamtes Handeln dem unterstellt, dass Menschen zu Nachfolgern von Jesus werden und auf Zeit und Ewigkeit gerettet werden, dann braucht es die folgenden Punkte auch nicht.
Wo der Missionsauftrag aber im Zentrum ist, da könnte es durchaus Sinn machen, auch auf die folgenden Punkte zu achten, wenn man sich fragt: Was macht Kirche zukunftsfähig?
2Gleichberechtigung der Formen

Ich rede und schreibe als Pfarrer einer Landeskirche. Das als kleine Vorbemerkung, weil dieser Punkt wohl nicht auf alle Gemeinden zutreffen wird.
Kirche ist nur dann zukunftsfähig, wenn sie sich aus dem Korsett der Tradition befreit. Bevor du Schnappatmung bekommst: Ich sage damit nicht, dass jede Tradition ein Korsett ist. Aber einiges schon.
Pfarrerinnen und Pfarrer werden heute nach wie vor darin ausgebildet, eine Art von Gottesdienst zu halten, der seit Jahrzehnten immer weniger besucht wird. Das ist doch unlogisch, oder? Nein, das ist kirchliches Denken! Und das verstehe ich nicht. Wenn ich merke, dass etwas nicht funktioniert, dann ändere ich es. Punkt. Wenn ich es nicht ändere, nehme ich es blindlings und naiven Glaubens hin, dass es ja doch vielleicht eventuell am Sankt Nimmerleinstag besser werden könnte. Und dafür werden dann Millionen Kirchensteuergelder eingesetzt. Hmmm, da wird man doch mal fragen dürfen, ob das so sinnvoll ist?
Zu einer Gleichberechtigung der Formen gehört aber eine ganze Menge: Im Herbst wird in der Evangelischen Landeskirche in Baden ein neuer Landesbischof gewählt. Wie wäre es, wenn die Wahlkommission nur mal diese beiden Punkte berücksichtigt: Wir benötigen einen Bischof, der sich zurückbesinnt auf den Ur-Auftrag von Kirche und der dafür steht, dass Formen kirchlichen (vor allem gottesdienstlichen) Lebens gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Dann werden Pfarrerinnen und Pfarrer nicht nur darin ausgebildet, einen Talar zu tragen, liturgische Formeln zu sprechen (und deren Bedeutung und Ursprung zu kennen, was ich wirklich (!) mega spannend und interessant fand im Vikariat), Lieder zu kennen, die nicht mehr unsere Sprache sprechen, die von einem Instrument begleitet werden, das heutzutage nur noch sehr wenige Menschen hören.
Sondern Pfarrerinnen und Pfarrer lernen, wie gleichberechtigt und nicht stattdessen Gottesdienste im 21. Jahrhundert aussehen können, die Menschen ansprechen und der Gottesdienstbesuch wieder wächst, ebenso wie solche Gottesdienste ästhetisch, musikalisch und gestaltungsdynamisch (altdeutsch: liturgisch) ein wahres Fest für Menschen der heutigen Zeit sind.
Das aber wiederum würde bedeuten, dass das Ausbildungssystem unserer Landeskirche(n) sich radikal ändern müsste. Und nochmal: Es geht nicht darum, „das eine“ neben „dem anderen“ zu dulden – es geht um eine Gleichberechtigung der Formen.
3Digitalisierung fördern

Als ich vor Weihnachten mit einer Person aus dem Oberkirchenrat unserer Landeskirche telefonierte, fragte ich sie, was das nächste Projekt sei, das die Landeskirche im Bereich Digitalisierung voranbringen wolle. Antwort: Ein digitales Akten- und Archivierungssystem.
Ernsthaft?
Wo andere Gemeinden sich Gedanken darüber machen, wie sie im Zuge der Digitalisierung mehr Menschen erreichen können durch Streaming-Angebote, durch hybride Gottesdienstformate, durch digitale Arbeitssysteme (so genante Work OS [Work Operating System]) oder diverse Apps – überlegt „meine“ Landeskirche, wie Akten und Daten besser digital archiviert und verwaltet werden können.
ACHTUNG: Ich halte das für superwichtig und notwendig, denn die gleiche Landeskirche kam in der jüngsten Vergangenheit auf die Idee: „Komm, alle reden von Digitalisierung, wir blähen die Verwaltung etwas auf und entwerfen neue Formulare im Rechnungswesen, die die Arbeit erschweren.“ Deswegen ist ein digitales Akten- und Archivierungssystem super hilfreich – aber jetzt? Wirklich jetzt? Ist es jetzt die richtige Zeit, genau darüber zu reden und dieses Projekt zu priorisieren?
Ich erlebe in meiner Gemeinde Folgendes: Auch Menschen, die weder „digital natives“ noch „U60“ sind, widmen sich den digitalen Medien wie YouTube, Videokonferenzen, WhatsApp und unserer Smartphone-App für die Gemeinde und kommen bestens damit klar, sind informiert und vor allem: Sie bleiben dadurch Teil der Gemeinschaft, die gerade vieles (nicht alles!) in den digitalen Raum verschieben muss.
Nein, die Digitalisierung ist nicht der Weisheit letzter Schluss und schon gar kein Patentrezept für gelingende Gemeindearbeit. Sie ist aber eine Form, die Teilhabe an gemeindlichem Leben ermöglicht – und zwar gerade denen, die unter den momentanen Umständen leiden und die dadurch auch in Zukunft leicht(er) Teil haben können an Gemeinde.
Insofern ist ein guter Digitalisierung-Prozess kein „nice to have“, sondern Grundlage, wenn Kirche zukunftsfähig sein will.
4Nicht „für“ sondern „mit“ den Menschen

Wir sollten aufhören zu denken, dass wir als Kirche etwas „für“ Menschen „anbieten“. Das führt unweigerlich zu einer „Wir – Sie“-Konstellation und verstärkt ein „Drinnen – Draußen“-Denken, das nicht wirklich hilfreich ist.
Natürlich kann man das nicht in allen Bereichen von Kirche durchdenken und auf gleiche Weise praktizieren. Nur ein Beispiel: In unserer Gemeinde haben wir unser Kleingruppen-Konzept so ziemlich auf den Kopf gestellt, weil das bisherige nur sehr wenig Wachstum brachte. Das neue Kleingruppen-Konzept denkt wesentlich inklusiver und nicht abgrenzender. Es geht nicht darum, sich um Bibel, Tee und Salzbrezeln zu versammeln, sondern das zu tun, wofür mein Herz ohnehin schon schlägt (das kann auch die Kombination Bibel, Tee und Salzbrezeln sein) und dafür Menschen gewinnen und begeistert, dass sie es gemeinsam mit mir tun. Wo sie auf ihrer Glaubensreise stehen? Vollkommen egal. Sie müssen aber eines nicht sein: Helden im Glauben!
Genauso der Gottesdienst: Er ist keine abgehobene Versammlung ein paar durchgeknallter Religiösen, sondern ein Ort, an dem Menschen Gott kennenlernen. Das bedeutet, dass der Gottesdienst (wir sind noch mittendrin im Veränderungsprozess) konsequent von Gästen und Besuchern her gedacht und konzipiert wird. Und mit Verlaub: Da fallen mir schon so manche Gottesdienstformate ein, die einfach nicht flächendeckend einladend sind und das Klischee bedienen, dass Kirche „altbacken“ und „verstaubt“ sei. Das ist sie aber nicht – sie macht nur manchmal den Eindruck.
Und auch nicht jede liturgisch traditionelle Form ist per se schlecht, nur sollten wir die Augen offen halten und sehen, ob wir wirklich „mit“ den Menschen unterwegs sind.
5Experimentierfreudigkeit kultivieren
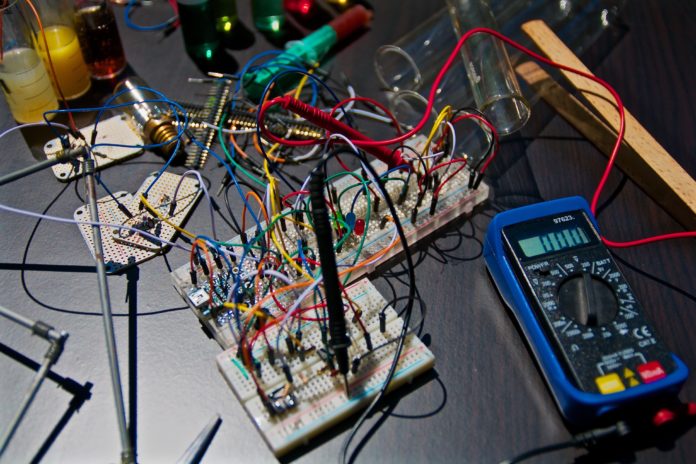
Experimentierfreudig sein – ist das eine. Diese Experimentierfreude zu fördern – das andere.
Ich erlebe Kirche oft so: A hat eine ziemlich coole Idee. Um diese umzusetzen, benötigt er aber B, C und D, die ihm mit Ressourcen wie Geld, KnowHow, Ermöglichung und Zeit zur Seite stehen. B würde gerne erst mal einen ausgefeilten 10 Punkte-Plan sehen. C möchte, dass diese coole Idee aber nicht nur der einen Zielgruppe, sondern der gesamten Gemeinde zugute kommt. D „weiß nicht so recht, was er davon halten soll und betet erst mal“.
Die Folge: A ist ziemlich frustriert, das Experiment findet nicht statt und die coole Idee nie den Weg in die Gemeinde. Dummerweise pausiert das Leben in dieser Zeit nicht, geht weiter und der „Kairos“, der entscheidende Moment, für diese Chance wurde verpasst.
Ganz ehrlich: Kirche ist manchmal so schrecklich behäbig und kompliziert. Ich wünschte mir, all den „A“-Typen dieser Welt zu sagen: „Kommt zu uns und….“ oh, warte. Wir haben auch einige B-, C- und D-Typen am Start. Das wird wahrscheinlich überall der Fall sein.
Ich glaube, ausgerechnet jetzt ist nicht die Zeit, um sich lange Gedanken zu machen. In einer Welt, die sich immer schneller wandelt, müssen wir auch mal losgehen, durchstarten und auf die Nase fallen, um dann wieder aufzustehen, aus den Fehlern lernen und neu durchstarten. Das müssen wir in Gemeinden kultivieren – und eben nicht nur „akzeptieren“, wenn Fehler entstehen.
6Ehrlich währt am längsten

Was ich jetzt schreibe, ist alles andere als wissenschaftlich fundiert. Aber ich könnte wetten, dass eine Menge Dinge, die in der Gemeinde geschehen, nur deswegen geschehen, weil verantwortliche Personen nicht ehrlich sind. Das zeigt sich vor allem daran, dass es zu manchen Dingen in der Gemeinde einfach keine Erklärung gibt.
Das unausgesprochene Pendant zu „Das haben wir schon immer so gemacht!“ ist „Ich find’s auch doof – aber wenn wir das Thema angehen, steigt uns eine bestimmte Gruppe aus der Gemeinde auf’s Dach!“ Also reiten wir das tote Pferd weiter.
Ich glaube, dass in vielen, vielen Gemeinden unter diesem Deckmantel der Angst Dinge weitergeführt werden, weil man sich nicht traut, sie offen und ehrlich auszusprechen. Ja – manches davon findet seinen Ursprung in schlechter Leiterschaft. Aber nicht alles. Und ich wünsche mir und glaube, dass Kirche nur dann zukunftsfähig ist, wenn sie ehrlich wird – zu sich selbst.
Das kann ja auch durchaus einen befreienden Charakter haben, wenn man nämlich die Dinge ausspricht und feststellt: Eigentlich geht es anderen ganz genauso wie mir. Ich habe das schon erlebt – und am Ende steht meistens, das die ganze Gruppe herzlich lacht. Kein Scherz! Und Lachen tut gut. Lachen ist die beste Medizin. Das wissen wir. Also nur Mut zu mehr Ehrlichkeit!
7Ehrenamtliche nicht nur den Drecksjob machen lassen

Ok, das ist provokant. Aber wir sind jetzt schon vorangeschritten im Artikel und ich wollte einfach deine Aufmerksamkeit ein wenig pushen.
Gleichzeitig meine ich damit: Kirche lebt davon, dass jeder etwas dazu beiträgt, weil Gott unabhängig von Ämtern begabt. Es gibt in meiner Gemeinde Dinge und Arbeitsbereiche, die würde man klassischerweise sehr wahrscheinlich unbedingt dem Pfarrer zuschreiben. Der (konkret: ich) kann das aber nicht. Also machen es Menschen, die es können, die eine Leidenschaft dafür haben und die Gott dafür begabt hat. Und ich kann mich mehr Dingen widmen, die ich wirklich kann und in denen ich von Gott begabt bin.
Natürlich ist mir klar, dass ich als Pfarrer und damit Leiter der Gemeinde auch eine Verantwortung trage – keine Frage. Nur sind mir Ämter und Titel schnuppe. Sobald ich merke, dass Gott eine Person richtig stark gesalbt und befähigt hat in einem Bereich, der eigentlich bei mir angedockt ist, muss ich loslassen und diese Person diesen Bereich übernehmen lassen.
Wie heißt der zwar abgedroschene aber zutiefst wahre Satz: Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen.
Und ich würde hinzufügen:
Gott beruft nicht die Amt- und Würdenträger, sondern gibt den Berufenen Amt und Würde.
Das sind 7 Gedanken. Alles andere als auf Vollständigkeit und der Weisheit letzter Schluss überprüft. Einfach Gedanken, die ich persönlich für wichtig halte.
…und wenn du Lust und Zeit hast, am 18. März dabei zu sein, klick dich hier rein:

https://joinclubhouse.com/event/m74wl203

Noch mehr inspirierenden Content bekommst du in meinem Podcast „Einfach glauben“. In einer immer komplexer werdenden Welt, helfe ich dir genau dabei: einfach glauben!
In diesem Podcast bekommst du Anregungen und Inspiration wie „einfach glauben“ mitten im 21. Jahrhundert, mitten im Alltag, mitten in deinem Leben geht.
Meinen Podcast „Einfach glauben“ findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Anklicken, anhören, abonnieren.
Apple Podcasts | Deezer | Spotify | www.david-brunner.de/podcast/