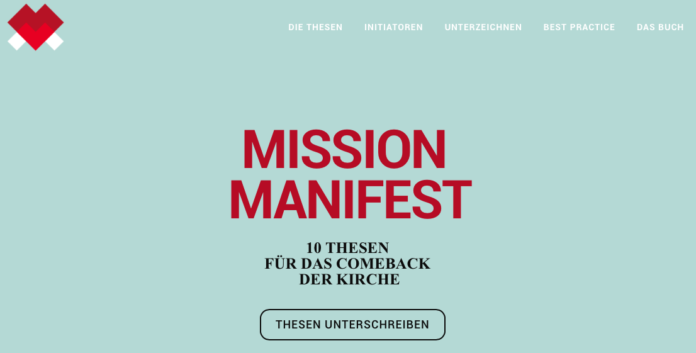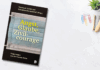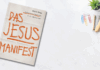Ich liebe Bücher, die auf allegorische Weise erzählen, wie einfach eigentlich der Glaube doch ist. Begonnen hat es mit der Circle-Trilogie („Black“, „Red“, „White“) von Ted Dekker, weiter geht’s mit „Der Schrei der Wildgänse“ und aktuell ist es das Buch „Die Stimme des Königs“ von Brad Huebert. Ich will es dir absolut ans Herz legen, dieses Buch zu lesen – deswegen werde ich nicht viel über dieses Buch an sich schreiben, um dir nicht die Spannung zu nehmen – aber: Lies es!
Auf Seite 115 findet sich eine Aussage über den Glauben, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Ich „übersetze“ diese Aussage ein wenig aus dem Zusammenhang des Buches, da ich sonst erst einmal die ganzen Protagonisten der Erzählung hier vorstellen müsste – und das würde etwas weit gehen.
Wunder geschehen nicht durch Beten. Sie geschehen durch das Zusammenwirken des Menschen mit Gottes Geist auf der Welt. Glaube ist ein Dialog des Gehorsams, der ganz unterschiedliche aussehen kann. Manchmal wird er ein Gebet, manchmal wird daraus eine Umarmung, ein Essen, eine Schulter zum Ausweinen, ein Moment der Heilung oder ein furchtloses Eintreten für Gerechtigkeit. Wenn der Mensch betet, wo Gott eigentlich möchte, dass er handelt, ist das Gebet nutzlos. Wenn der Mensch handelt, wo Gott eigentlich möchte, dass er betet, handelt der Mensch aus eigener Kraft.
Bevor du weiterliest: Lies das Zitat nochmals durch. Es lohnt sich.
Dialog des Gehorsams
Ich liebe diese Beschreibung – sie ist so herrlich paradox. Dialog und Gehorsam – klingt nicht eher nach schlechter Pädagogik? Das mag daran liegen, dass wir „Gehorsam“ negativ bewerten, was ganz unterschiedliche Gründe hat. Gehorsam ist aber an sich überhaupt nicht schlecht. Gehorsam aus Liebe und Vertrauen ist das Beste, was einem Menschen geschehen kann, weil er ein verlässliches Gegenüber hat, das es wert ist, den Gehorsam zu bekommen.
Eltern wünschen das von ihren Kindern und wenn fehlbare Eltern es schon wert sind – wie viel mehr dann Gott? Kein Kadavergehorsam, aber ein Gehorsam aus dem Wissen heraus: Wenn einer es nicht nur gut meint sondern wirklich durch und durch gut ist – wie doof wäre ich dann eigentlich, wenn ich ihm nicht gehorsam bin? Aber der menschliche Geist scheint auf Rebellion angelegt zu sein, weswegen ein Restzweifel im menschlichen Denken bleibt, ob Gott es wert ist, ihm Gehorsam zu leisten – und schnell erhebt sich der Mensch über Gott.
Ohne gleich ein großes Fass aufzumachen, ist das klassischste Beispiel für mich die Frage nach der Herangehensweise an die Bibel als Wort Gottes („Hermeneutik“ nennt man das im Fachjargon).
Aus diesem Wissen der Tiefe und der Verlässlichkeit des Gehorsams nun in einen Dialog mit Gott treten zu dürfen, sollte unsere Seele jubilieren lassen!
Zusammenwirken mit Gottes Geist
Alleine der Gedanke daran sollte uns schon die Schuhe ausziehen! Gottes Geist liebt es, mit Menschen zusammenzuwirken. Er liebt es, uns mit rein zu nehmen in sein heilsames Wirken hier auf der Erde. Klar – das sieht immer anders aus und – zugegeben – ist auch nicht immer leicht zu erkennen.
Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so, dass es unverfügbar wäre, wie viele Theologinnen und Theologen, Pfarrerinnen und Pfarrer immer wieder behaupten und dann den schlauen Spruch bringen: „Der Geist weht eben wo er will.“ Damit nehmen sie Bezug auf eine Bibelstelle, die leider aber was komplett anders aussagt:
Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. (Die Bibel, Johannes 3,8)
Da steht überhaupt nichts davon, dass der Geist Gottes weht – und ja, mir ist schon klar, das das Wort für „Geist“ das gleiche ist wie für „Wind“. Nur macht’s auf Grund des Zusatzes „Du hörst zwar sein Rauschen“ und dem Nachsatz „So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist“ überhaupt keinen Sinn, davon auszugehen, dass Johannes 3,8 sagen will: „Gottes Geist weht, wo er will.“
Natürlich steht es in seiner göttlichen Autorität zu wehen, wo er will. Schon klar – aber manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass es nichts weiter ist, als ein Schönreden dessen, dass das Geistwehen grad nicht so stark ist oder nicht wahrgenommen wird.
Vielmehr ist hier davon die Rede, dass es sich so verhält bei einem Menschen, der aus dem Geist Gottes geboren ist – sprich: neu geboren oder wiedergeboren ist, von Neuem geboren ist, ein neuer Mensch wurde, weil Gottes Geist in ihm lebt.
Und mit diesem Geist Gottes, der zu Beginn aller Schöpfung schon präsent und am Wirken war, ist es jedem Christen möglich, zu kooperieren (=zusammenzuwirken). Noch ein Grund, dass unsere Seele jubiliert.
Und was machen wir draus? Gesetze!
Der Haken an der Geschichte ist nun, dass Christen über die Jahrhunderte bis heute die Kirche regelrecht selbst kraftlos machen, weil sie Regeln und Gesetze aufstellen, wie man sich nun als Christ zu verhalten habe und wie nicht.
Von wegen „10 Gebote“ – viele Gemeinden, Denominationen, Christen und Kirchen kennen noch viel mehr Gebote:
- Du musst jeden Sontag in den Gottesdienst.
- Du musst jeden Tag in der Bibel lesen.
- Du musst vor dem Essen beten.
- Du musst jeden Tag mit Gott reden zu bestimmten Zeiten.
- Du musst fasten.
- Du musst die Stille suchen.
- Du musst 10% deines Einkommens spenden.
- Du musst vor dem Abendmahl alle Sünden bekennen.
Ich kann’s echt nicht mehr hören! Weißt du, was ich muss? Gar nix! Und du auch nicht! Wenn du diese Listenpunkte (und viele weitere) nur erfüllst, um dein frommes Gewissen zu beruhigen: Dann lass es – und such dir jemanden, mit dem du darüber redest, wie du von diesem frommen Pflichtbewusstsein befreit werden kannst.
Gott sehnt sich nach dir in einer Liebesbeziehung und nicht in einer Pflichtbeziehung. Er möchte dein Herz erfüllen und nicht dich knechten, weil du mal wieder einen (oder mehrere) Punkte nicht erfüllst.
Wir haben’s verbockt!
Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass ich denke: „Wir haben’s echt verbockt!“ Was haben wir aus dem Glauben an Jesus gemacht? Was haben wir aus dieser wunderbaren Herzensbeziehung gemacht? Oftmals einen trockenen, pflichtbewussten und leblosen Glauben, weil wir aus ihm gesetzliche Vorschriften gemacht haben. Oder kurz: wir haben einen ziemlich kranken Glauben daraus gemacht.
Das perfide an der ganzen Geschichte ist ja: die „Erfüllung“ dieser Gesetze ist an sich nicht schlimm. Beten, in der Bibel lesen, für Gerechtigkeit einstehen, sich um Bedürftige kümmern, sonntags in den Gottesdienst zu gehen und einen bestimmten Betrag zu spenden – alles gut. Alles super. Keine Frage. Aber vollkommen leblos, wenn es aus Pflichtbewusstsein geschieht. Solltest du dich mal fragen (oder es schon getan haben), warum es dir diese „Dinge“ keinen Spaß machen, obwohl sie doch so herrlich fromm sind – dann könnte es daran liegen, weil du sie tust, weil „man das halt so macht“.
Es gibt Hoffnung auf Heilung!
Denn aus der Liebe zu Jesus, dem Dialog des Gehorsams und dem Zusammenwirken mit Gottes Geist heraus wirst du merken, wie gut dir die Dinge, die ich oben aufgelistet haben, tun. Aber erst Glaube – dann Taten. Nicht andersrum, denn das geht in die Hose und hinterlässt in dir ständig ein Gefühl des Ich-werde-Gott-einfach-nicht-gerecht. Das stimmt ja auch. Das wirst du nicht, denn das bist du schon – durch Jesus!
Und dann, ja dann ist der Glaube eigentlich ganz anders: Freude, Lachen, Liebe, Annahme, Geborgenheit, Freisein, Vergebung, Heilung, Trost, Kraft, Hoffnung und vieles mehr. Was wäre unser Leben doch reicher und schöner, wenn diese Dinge immer mehr durch den Glauben an Jesus in uns groß und stark und kräftig werden – und eben nicht weil wir „müssen“, denn:
Glauben kann keinerlei Spuren von „Müssen“ enthalten
Manchmal brauche ich solch ein Buch, das mich wieder mal auf allegorische Weise daran erinnert, was es mit dem Glauben eigentlich auch sich hat und wo ich selbst schief gewickelt bin, wo ich Meinungen und Vorstellungen vom Glauben folge, die Gott sicherlich nicht so erfunden hat – die sich aber in frommen Kreisen so festgesetzt haben, dass man sie beginnt zu glauben und ihnen nachzujagen (Leser des Buches „Die Stimme des Königs“ werden bei diesem Wort aufhorchen) – ohne zu hinterfragen.
Lies das Buch „Die Stimme des Königs“ – und noch viel wichtiger: Hör einfach auf die Stimme des Königs. Lass ihn zu dir reden – und folge seiner Stimme!
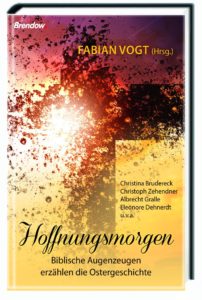


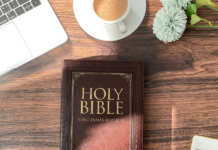
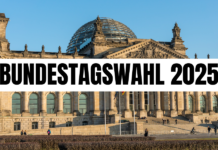
















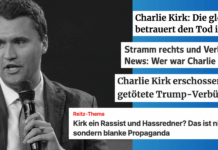






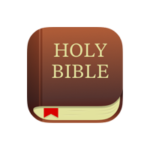


 Ich erinnere mich noch an Jorginho. Seines Zeichens war er Kapitän von Bayer Leverkusen und hatte damals (es ist schon wirklich einige Jahre her) beim Begrüßen vor dem Spiel nicht nur den Wimpel des Vereins getauscht. So war es an sich üblich zwischen den Kapitänen zweier Mannschaften, die sich gleich 90 Minuten einen erbitterten Fight liefern werden.
Ich erinnere mich noch an Jorginho. Seines Zeichens war er Kapitän von Bayer Leverkusen und hatte damals (es ist schon wirklich einige Jahre her) beim Begrüßen vor dem Spiel nicht nur den Wimpel des Vereins getauscht. So war es an sich üblich zwischen den Kapitänen zweier Mannschaften, die sich gleich 90 Minuten einen erbitterten Fight liefern werden.