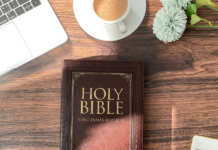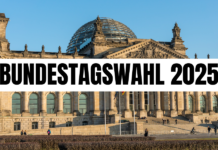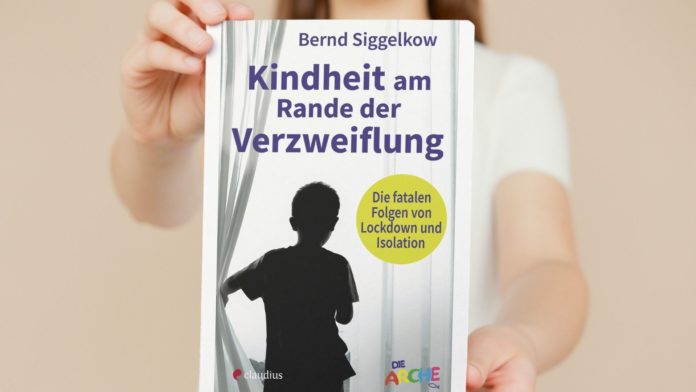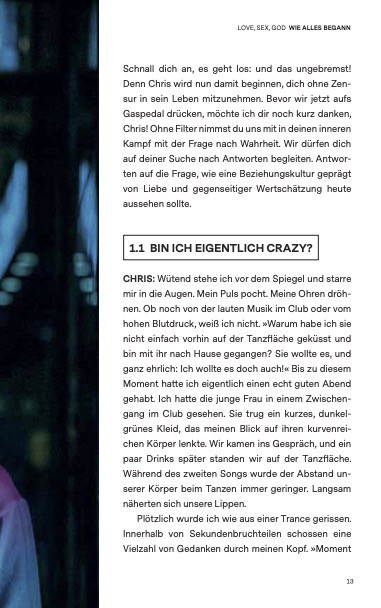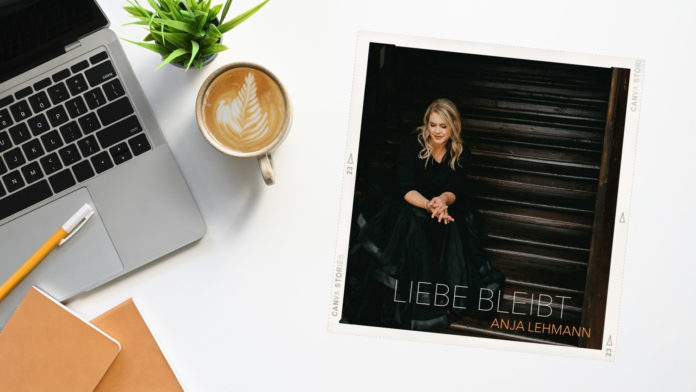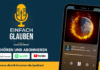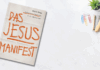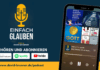Vor kurzem begegnete ich dieser Frage auf Facebook.
Mein erster Gedanke: „Äh – nein! Er war und ist Sohn Gottes, frei von aller Sünde und frei von aller Krankheit. Die Krankheitsresistenz in Person. Wieso soll er sich impfen lassen?“
Mein zweite Gedanke: „Alles schön und gut – aber wieso hat er sich taufen lassen?“
Kleiner Exkurs: Menschen lassen sich taufen, weil sie ihr Bekenntnis zu Jesus Christus bekräftigen wollen und weil sie ein Statement setzen: „Ich gehöre zu Jesus!“ (Leider hat die Landeskirche über die Jahrhunderte hinweg die Sache verdreht und die Säuglingstaufe zum Nonplusultra erklärt – aber das wäre ein anderes Thema. Wenn es dich interessiert, lies doch mal das hier: 10 Gründe für die Gläubigentaufe)
Zurück zur Ausgangsfrage: Würde sich Jesus impfen lassen?
Bevor du weiterliest: Lass doch mal deine Meinung da in der Umfrage – und keine Sorge: Das ist alles anonym!
Jesus und die Medizin
Wenn ich in das Neue Testament reinschaue, dann erkenne ich zwei Dinge. Zum einen jede Menge Wunderheilungen, die Jesus vollbracht hat: Lahme können wieder gehen, Blinde sehen wieder und Besessene werden befreit – um nur ein paar Dinge zu nennen. Jesus durchbricht das damalige (und heutige) Verständnis von Medizin, indem er sich sagt: „Egal, ob deine Krankheit selbst verschuldet ist, du unzählige Ärzte besucht hast oder die Menschen denken, dass du ohnehin keine Chance mehr hast: Ich heile dich jetzt. Bitteschön! Gern geschehen!“
Ist Jesus deswegen der Medizin gegenüber feindlich eingestellt und nimmt die Dinge lieber selbst in die Hand? Nein! An keiner mir bekannten Stelle im Neuen Testament kann ich irgendwo herauslesen, dass Jesus die Menschen heilte, weil er der Medizin nicht vertraute. Darüber hinaus: Eine seiner Biografien und die (Wunder-)Taten der ersten Christengeneration wurden von einem Menschen namens Lukas aufgeschrieben. Und dieser war Arzt (nachzulesen in der Bibel in Kolosser 4,14).
Es wäre doch recht unglaubwürdig, wenn Jesus die Ärzte damals verachtet hätte und gleichzeitig ein Arzt sich dranmacht, das so genannte „lukanische Doppelwerk“ (Lukasevangelium und Apostelgeschichte) zu schreiben.
Jesus kannte keine Abstandsregel
Was ich im Zusammenhang mit dieser Frage aber bemerkenswert finde: Jesus ging vollkommen frei und offen mit Krankheit um. Für die damalige Zeit ziemlich verrückt – denn: Menschen galten (je nach Krankheit) als unrein, als besonders schlechte Menschen und vor allem als eines: unnahbar! Aber nicht, weil sie so toll wären und wie Stars in den Himmel gelobt worden wären. Vielmehr deswegen, weil man sich ihnen nicht nähern durfte.
Gerade Menschen, die einen Aussatz hatten (eine Art Lepra), der hochansteckend war, lebten wie in kleinen Slums vor den Toren der Städte. Sie mussten an ihren Gewändern eine Klingel anbringen (wie heute beim Fahrradfahren) und wenn ihnen jemand ins Sichtfeld trat „unrein, unrein“ rufen. Damit wusste jeder: „Ich mach hier mal ’nen großen Bogen und halte mehr als 1,5 Meter Abstand.“
Stell dir das nur mal so ein bisschen in der Realität vor: Diese Menschen waren ausgegrenzt, sie konnten nicht am öffentlichen Leben teilnehmen, sie waren stigmatisiert, man zeigte auf sie (natürlich nur mit ausreichend Abstand), man spottete über sie, man machte sich lustig, sie waren die Minderheit – und die Mehrheit tat nichts, um ihnen zu helfen.
Falls du zu unserer heutigen Zeit noch keine Parallelen gefunden hast, lies den letzten Abschnitt nochmal.
Lasst mich durch – ich bin Arzt!
Und Jesus? „Vergiss den Abstand! Ich liebe diesen Menschen! Sein Leid verleidet mein Leben. Seine Schmerzen drehen mir die Eingeweide herum! Kann ihm denn keiner helfen? Will sich keiner seiner annehmen? Bin ich eigentlich der einzige hier, der Mitleid mit diesem Menschen hat? Ich geh‘ jetzt zu ihm hin und heile ihn. Lasst mich in Ruhe mit dem „Unrein-Klingel-Gedöns“ – dieser Mensch benötigt Liebe, Zuneigung und Heilung. Lasst mich durch! Ich bin Arzt!“
That’s it. So ist Jesus. Den Menschen zugewandt, liebevoll und barmherzig.
Er hat bis heute nur das Beste im Sinn für den Menschen, für jeden einzelnen, für dich. Seine ganze Art ist heilsam und liebevoll – nicht belehrend und nicht moralisch (auch wenn manche aus ihm so einen moralischen Lehrer machen).
Er geht auf die Menschen zu – egal, was die gesellschaftliche Norm gerade meint, vorschreiben zu können. Political correctness? Kennt Jesus nicht. Interessiert ihn nicht. Ist nicht in seinem Wortschatz enthalten.
Ihm geht es nur darum, jedem Menschen zugewandt, liebevoll und barmherzig zu begegnen.
Die falsche Frage
„Würde sich Jesus impfen lassen“ ist die falsche Frage. Ich könnte auch fragen: „Würde Jesus einen SUV fahren? Wäre Jesus bei den Friday For Futures-Demonstrationen mit am Start? Wäre Jesus Fan vom Karlsruher SC oder vom VfB Stuttgart? (Gut, hier liegt die Antwort auf der Hand.)“
Würde sich Jesus impfen lassen? Wieso? Er brauchte die Impfung nicht für sich selbst und auch nicht für andere. Er war unheilbar gesund an jedem einzelnen Tag seines Lebens.
Würde er vielleicht ein Zeichen setzen wollen und sich doch impfen lassen, damit andere es ihm gleichtun? So ähnlich wie mit der Taufe?
Würde sich Jesus impfen lassen?
So unentschlossen wir sein mögen – entscheidend ist, mit welcher Haltung und inneren Einstellung wir mit diesem Thema der Impfung umgehen.
Wenn wir uns schon ein Beispiel an Jesus nehmen, wiederhole ich gerne den Satz von oben:
Wie wäre es, wenn du dir Jesus auf diese Weise als Vorbild nimmst?
Konkret: Versuche doch mal, deinem Nächsten zugewandt, liebevoll und barmherzig zu begegnen – vollkommen unabhängig, ob er geimpft ist oder nicht.
Glaube mir: Wir würden diese Welt verändern. Zum Positiven, zum Guten, zum Heilsamen! Und ist es nicht das, was wir dringender benötigen denn je?