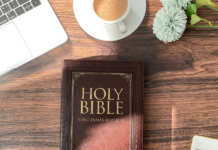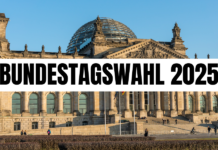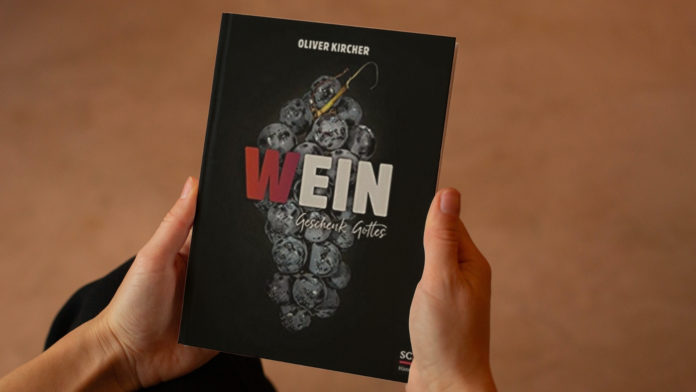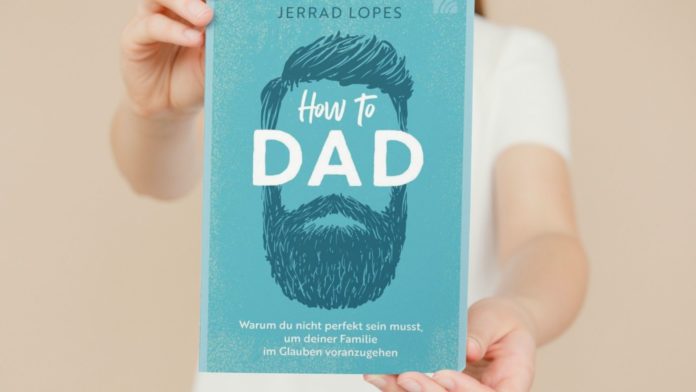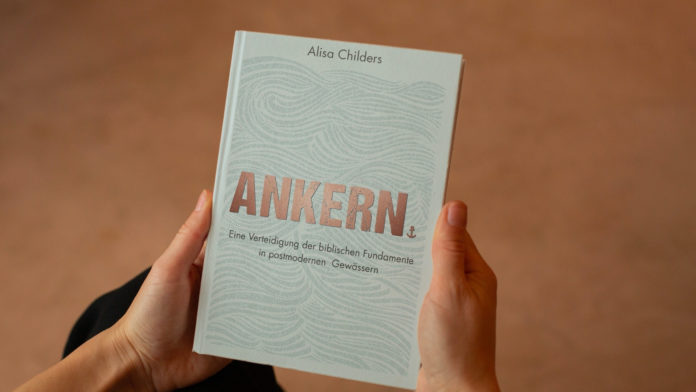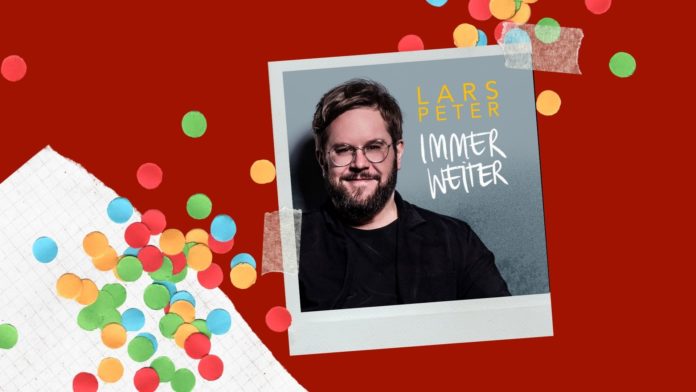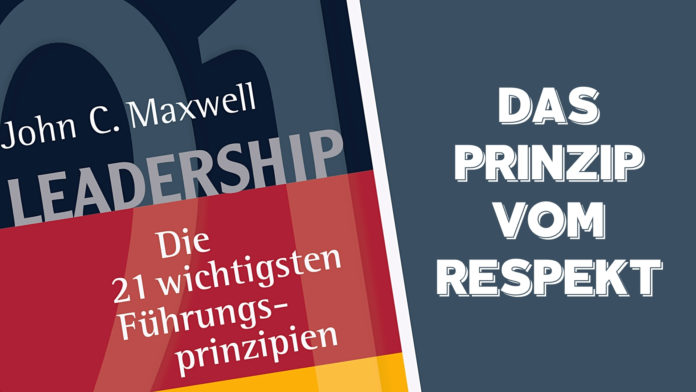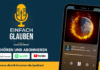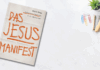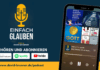Zuweilen habe ich den Eindruck, dass dieser Satz auf nicht wenige Pfarrerinnen und Pfarrer zutrifft. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was gibt mir meine Identität? Dass ich predige!
Ursprünglich klingt der Satz anders. Er stammt aus der Feder des Philosophen und Mathematikers René Descartes und lautet:
Ich denke, also bin ich!René Descartes (1596-1650)
Descartes ging es darum, sich seiner eigenen Existenz und Erkenntnisfähigkeit sicher zu sein. Das letzte tragfähige Fundament und Anzeichen dafür ist seiner Meinung nach das Denken. Weil der Mensch denkt, ist er. Weil ich weiß, dass ich denke, bin ich. Das Denken stiftet sozusagen meine Identität und versichert mich meines Daseins und meiner Daseinsberechtigung.
Nun empfinde ich genau diese Frage als eine enorm wichtige: Wer bin ich? Was macht mich aus? Was versichert mich meiner Daseinsberechtigung? Ich habe darüber an anderer Stelle einen wichtigen Beitrag geschrieben: Erkenne deine wahre Identität in Jesus!
Deswegen gehe ich in diesem Beitrag nicht darauf ein, was meine wahre Identität ist und wie ich sie finde, sondern vielmehr werfe ich eine Problemanzeige in den Raum, die vielleicht dem ein oder anderen eine Hilfe zur Selbsterkenntnis ist – oder zur Erkenntnis über seinen Pastor – ob dieser will oder nicht.
Der Drang, sich äußern zu müssen
Pfarrer und Pastoren sind notorische Sprecher. Kurze Anmerkung: „Pastoren“ sind die „Pfarrer“ der Freikirchen sowie der Landeskirchen ab Mitteldeutschland bis in den Norden. Denn auch dort heißen die „Pfarrer der Landeskirche“ Pastoren (vor allen in Norddeutschland) – im Süden werden die „Pfarrer der Landeskirche“ auch Pfarrer genannt – und Pastoren sind die „Pfarrer der Freikirchen“. Verwirrung komplett? Wunderbar. Ich verwende den Begriff „Pastor“ und „Pfarrer“ nicht streng getrennt – mal so, mal so und damit will ich allesamt vereinen und meinen.
Pfarrer und Pastoren können nicht anders als notorisch zu sprechen. Dieser Beruf legt es auch nahe. Gottesdienste, vor allem eben die Predigten, Andachten, Grußworte, Religionsunterricht, Meetings, Sitzungen, Besprechungen aber auch gedruckte Worte wie Gemeindebrief-Artikel, Pressemeldungen, Liturgien und Gottesdienstabläufe, Dienstanweisungen, Geburtstagsgrüße, Emails und Jobbeschreibungen für Mitarbeiter. Das alles spielt sich landauf landab in jedem Pfarrbüro ständig ab. Ein Pfarrer produziert Unmengen an Worten Tag für Tag.
An sich ist das auch nicht das Problem. Zum Problem wird’s nur dann, wenn ich nicht mehr merke, wann ich eigentlich auch mal ruhig sein sollte, nichts sagen sollte, nicht predigen sollte. Der Kabarettist Dieter Nuhr hat es einfach schön auf den Punkt gebracht:
Wenn man keine Ahnung hat – einfach mal die Fresse halten!Dieter Nuhr
Und genau das gelingt Pfarrern oft nicht. Leider. Ich sage nicht, dass ich es besser kann. In den letzten Jahren hab ich mir aber eine Haltung zu eigen gemacht, durch die ich auch mal „die Fresse halten“ kann. Ich sage dann: „Sorry, da habe ich keine Ahnung! Frag jemanden, der sich damit auskennt – oder wenn du möchtest, mache ich mich schlau und gebe dir dann eine Antwort.“
Was ich aber nicht mehr will: So zu tun, als hätte ich Ahnung und meinen Senf zu allen möglichen Würstchen dazu geben.
Ansonsten äußern sich Pfarrer und Pastoren mit einem großen Schuss Selbstüberzeugung zu Sachverhalten, von denen sie keine Ahnung haben, aber weil man so ein Wortgetriebener (und damit meine ich leider nicht das Wort Gottes) ist, muss man einfach etwas dazu sagen. Man kann nicht anders, es ist wie ein Zwang, der über einem hängt – Fresse halten? Geht nicht.
Ich bin doch darauf getrimmt zu predigen, zu verkündigen, andere (positiv) zu beeinflussen und zu inspirieren, ich muss, ich muss, ich muss einfach predigen, ob der andere es jetzt hören will oder nicht, ist ja sein Problem, nicht meins – also predige ich und predige ich und predige ich.
Es gibt ja so ein Sprichwort, das besagt:
Du kannst dem Deutschen alles nehmen – nur nicht seine Bedenken!Quelle unbekannt
Wir sind nun mal leider nicht nur eine Nation der Dichter und Denker, sondern auch der Nörgler und Motzer. Das scheint also auch zum identitätsstiftenden Merkmal des Deutschen zu gehören – frei nach Descartes:
Und leider beschleicht mich immer wieder das Gefühl, dass es bei Pfarrerinnen und Pfarrern ganz ähnlich ist. Du darfst ihnen alles nehmen – nur nicht das Predigen! Denn darüber definieren sie sich. Hier äußern sie sich meist politisch, gesellschaftskritisch, geistlich und manchmal sogar theologisch. Viele Predigten aber sind gespickt von „Eisegese“, also Dingen, die dem biblischen Text in den Mund gelegt werden, aber dort gar nicht stehen.
Warum nur?
Ich frage mich das oft – und ehrlich: Ich bin ja nicht besser. Frag mal meine Frau! Ich rede auch viel und schreibe viel – immerhin hast du es bis hierhin geschafft. Aber ich finde es sehr bedenklich, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer meinen, sich über das Predigen zu definieren. Nein, klar, logisch – das würde keiner so sagen. Nie im Leben! Genug „Geistliche“, die jetzt diese Zeilen lesen, werden innerlich kochen und denken: „Wie kann er nur? Wie kann er nur…..mich so ertappen?“
Ich glaube, es sind drei Gründe, die dem zugrunde liegen, dass Pfarrer so oft einfach nicht den Mund halten können, weil sie sich über das Predigen (in den unterschiedlichsten oben auch genannten Formen) definieren.
Prioritäten
Der erste Grund ist recht simpel: Wir lernen in unserer Ausbildung, dass die Predigt das Wichtigste ist. Klar – Liturgikdozenten würden das jetzt anders sehen, aber wenn ich sowohl auf Studium als auch Ausbildung (Vikariat) zurückblicke, dann gab es immer diesen Subtext: „Das Wichtigste an deinem Beruf ist das Predigen!“ Eigentlich nur in der Seelsorge lernen wir, auch mal zuzuhören. Ansonsten: predigen! Verkündigen! Mund aufmachen! Im Gottesdienst, im Reliunterricht, im Konfirmandenunterricht, Seniorenkreis, Ältestenkreis, Kindergottesdienst, Dienstbesprechungen, als Vorsitzender des Trägers eines Kindergartens und und und.
Alleine das Lernen der exegetischen Methoden (egal welche man nun präferiert) dient dazu, „später einmal“ einen biblischen Text sauber zu exegetisieren, also das „rauszuholen“ was drinsteckt und nicht reinzulegen, was nicht drinsteckt (das wäre die oben schon erwähnte Eisegese).
Das hat auch seine Berechtigung, denn durch das Predigen geschieht nicht nur Wortverkündigung, sondern dadurch leite ich als Pfarrer auch „meine Gemeinde“. Ich setze Akzente, ich kann mir sicher sein, dass wenigstens hier mir die Leute zuhören und dass ich ohne große Unterbrechungen zwischen 15 bis 45 Minuten reden kann – je nach Gemeinde.
Ich predige leidenschaftlich gerne, deswegen ist es mir vollkommen fremd, nun predigtkritische Töne anzuschlagen, aber ich glaube, dass ein guter Gottesdienst nur dann entsteht, wenn den anderen Elementen des Gottesdienstes ebenso eine hohe Aufmerksakmkeit in der Planung und Vorbereitung zukommt.
Einseitige Ausbildung
Der zweite Grund: Wir können nichts anderes! Das klingt süffisant bis lustig – aber ist so. Ein „normaler Pfarrer“ (in der Landeskirche) hat ein Studium der Theologie – das war’s. Was macht man mit dem Ding? Man wird Pfarrer – oder kann noch in den Religionsunterricht. Aber ansonsten ist es doch eher schwierig, auf Grund der Ausbildung irgendwo zu landen. Handwerksberufe, Dienstleistungssektor, IT-Branche oder Industrie – das alles bleibt einem auf Grund der Ausbildung verschlossen. Ich habe Theologie studiert – damit bewege ich mich in einem sehr, sehr engen Korridor der Berufslandschaft in Deutschland.
Wo andere Berufsausbildungen heutzutage durchlässiger sind für andere Formen des Berufs, da ist der Pfarrer mit seinem Theologiestudium irgendwie so das Männchen im Walde, das pfeift, um seine Angst zu vertreiben. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber seien wir doch bitte mal ehrlich: Auf der einen Seite ist da ein klassisches Theologiestudium mit Fächern wie Kirchengeschichte, Dogmatik, Praktische Theologie und Ethik. Auf der anderen Seite sind da im Pfarrberuf Dinge wie Haushaltsplan, Mitarbeiterführung, Kindergartenträgerschaft und Leitungsposition.
Ich meine – dass das hinkt und stinkt, ist ja jetzt nicht weiter verwunderlich. Ebenso wenig, dass man sich als Pfarrer dann auf das vermeintlich sichere Terrain zurückzieht, ist doch auch klar. Und klar ist auch, dass das Predigen nicht alles ist – es gibt ja weitere Kernkompetenzen wie Seelsorge und Religionspädagogik (Reliunterricht in der Schule sowie Konfirmandenunterricht), die vermeintlich (!) größte Wirkung jedoch meint der Pfarrer im Gottesdienst und hier vor allem in der Predigt zu erzielen.
Hach, es ist einfach zum Davonlaufen. Wir gelangen immer wieder an den Punkt, dass der Gottesdienst – und hier die Predigt – das Nonplusultra zu sein scheinen.
Pfarrer allein zuhause
Der dritte Grund: Einsamkeit. What??? Ja genau. Ich glaube, es ist wie in jedem anderen Beruf auch: Wo du keine Freunde hast, die in dein Leben hineinsprechen, dir auf die Sprünge helfen, dich stärken und ermutigen, aber auch korrigieren und zurechtweisen, da versuchst du über den Beruf deine Identität und Bestätigung zu bekommen. Das ist nun also wirklich nichts Pfarrer-Spezifisches. Das kannst du genauso als Softwareentwickler, Gärtner, Modeschöpfer, Versicherungsfachangestellter, Arzt, Bäckereifachverkäufer oder Lehrer.
Was aber sicherlich so ziemlich spezifisch ist (und in nur wenigen weiteren Berufen vorkommt), ist die Tatsache, dass man als Pfarrer mit recht vielen Menschen Kontakt hat – und das auch noch auf einer eher sozialen und zwischenmenschlichen Ebene – weniger auf einer betriebswirtschaftlichen oder produzierenden Ebene, auf der mein Gegenüber einfach nur mein Arbeitskollege ist. Das führt unweigerlich dazu, dass Ebenen durcheinander geraten bzw. miteinander in Berührung kommen und dadurch Äußerungen von zwischenmenschlichen Beziehungen sich in einem beruflichen Umfeld abspielen. Das ist nicht einfach – und sicherlich ähnlich wie in anderen Berufen, bei denen zwischenmenschliche Beziehungen sich auf einem beruflichen Level abspielen wie bspw. bei Ärzten. Allerdings mit dem Unterschied, dass ich im Normalfall mit meinem Hausarzt nicht auf Grund seines Berufes als Arztes in Meetings, Vorbereitungstreffen und Planungen mich zusammenfinde, aber seine professionelle Arbeit durchaus auch eine sehr persönliche Ebene in meinem Leben anspricht.
Bei Pfarrern ist es durchaus eine Challenge, mit ganz vielen Menschen zu tun zu haben, deren Erwartungen an zwischenmenschliche Beziehung andere sind als die, die ein Pfarrer erfüllen kann oder soll. Soll er denn mit der ganzen Gemeinde befreundet sein? Jeden einzelnen „gleich mögen“? So ein Quatsch! Wer das ernsthaft behauptet, soll sich in seine Höhle zurückziehen und im Mammutfell-Rock um’s Feuer tanzen.
Ich kann ja nur für mich sprechen, aber in meiner Gemeinde gibt es Menschen, die ich mega sympathisch finde; viele andere wiederum finde ich „nur“ sympathisch. Und andere wiederum….lassen wir das. Ich denke, du weißt, was ich meine.
Gleiches gilt aber auch andersrum: Nicht jeder in der Gemeinde mag den Pfarrer, gleichzeitig aber – und jetzt switche ich mal in den freikirchlichen Kontext – ist es die Gemeinde, die den Pastor finanziert (wie gut, dass es in der Landeskirche anders ist – die muss ja auch mal einen Vorteil haben gegenüber den Freikirchen).
Ein Dilemma. Und ich glaube, damit umzugehen, fällt vielen Pfarrern nicht leicht. Du bist die eierlegende Wollmilchsau, aber wirklich befreundet, so richtig tief mit ehrlichen Gesprächen bis tief in die Nacht, bist du mit einer Handvoll – wenn überhaupt.
Für manch einen nagt das dann am Selbstwertgefühl. Und wie bekommt man das noch mal zurück? Ach ja, richtig. Durch’s Predigen! Ein Teufelskreis. Im wahrsten Sinne.
Du liebst mich, also bin ich!
Hans-Joachim Eckstein hat diese Wendung ins Spiel gebracht. Schon vor vielen Jahren hat er Descartes‘ Äußerung umgemünzt im Blick auf Jesus und sagt: „Du liebst mich, also bin ich!“
Ich finde das eine sehr geniale Umwandlung dieser Aussage, die gleichermaßen in die Freiheit und in die Tiefe führt. Kein Mensch muss sich durch irgendetwas definieren, das er tut. Weder ein Fußballprofi, noch eine Lehrerin, weder ein Bäcker noch eine Managerin – und erst recht kein Pfarrer. Denn es geht nicht um das, was ich leiste, sondern um das, was ich bin. Geliebt.
Und daraus nun sollte man diese Gründe angehen. An der Ausbildung arbeiten (gut, ich gebe zu, das ist ein sehr großes Feld), die eigenen Kompetenzen stärken (auch fachübergreifend – es hindert mich niemand daran) sowie echte Freundschaften einzugehen und zu pflegen. Es gibt keinen Grund, weshalb diese drei Gründe für alle Ewigkeit fest zementiert sein sollten. Überhaupt nicht. Packen wir sie doch einfach an!
Und ich glaube fest daran, dass eine geliebte Person bzw. eine Person, die weiß, wie sehr sie von Gott geliebt ist, genau aus diesem Grund einen Unterschied in dieser Welt macht – und nicht auf Grund dessen, was sie leistet. Und mag es noch so fromm sein – und mag es noch so sehr das Predigen sein.
Bleib auf dem Laufenden und abonniere meinen Newsletter: