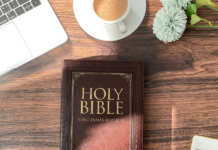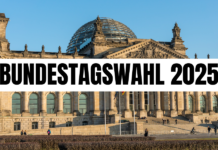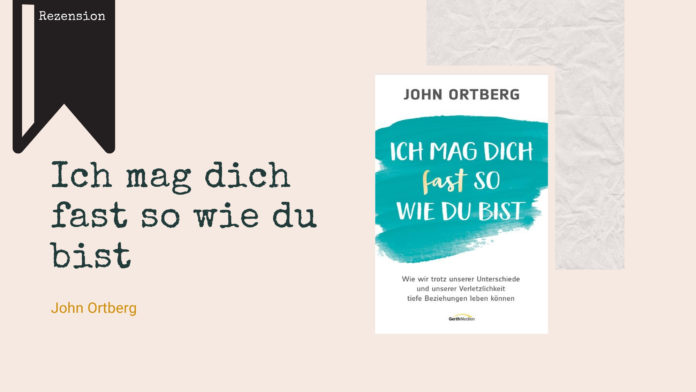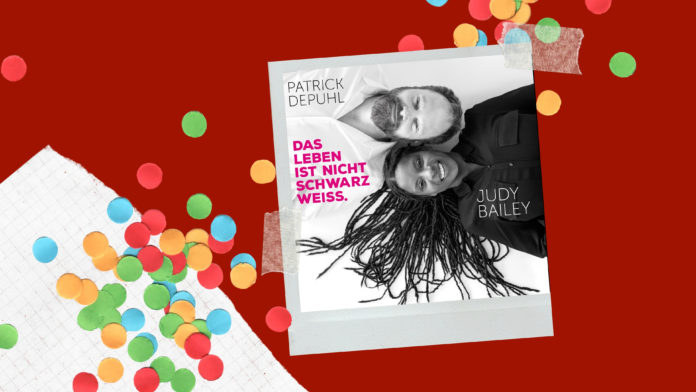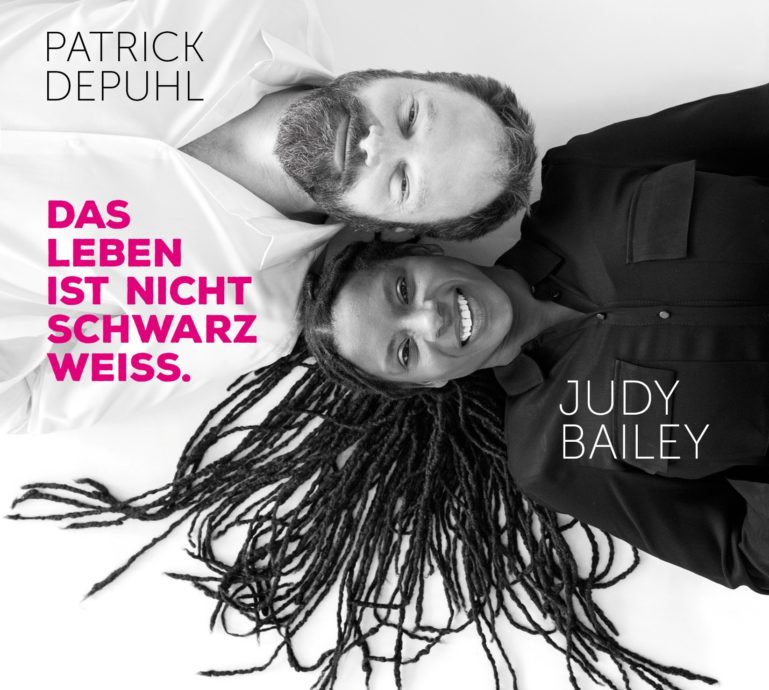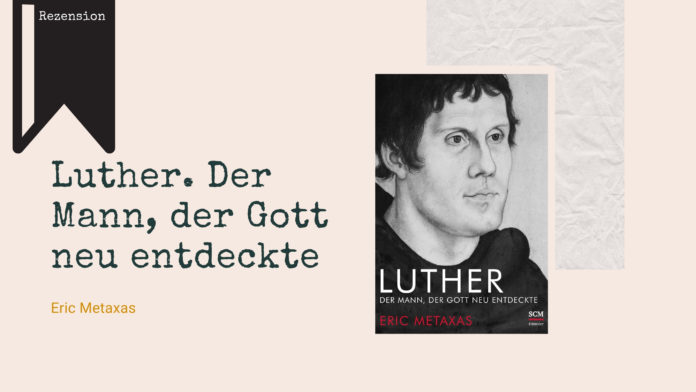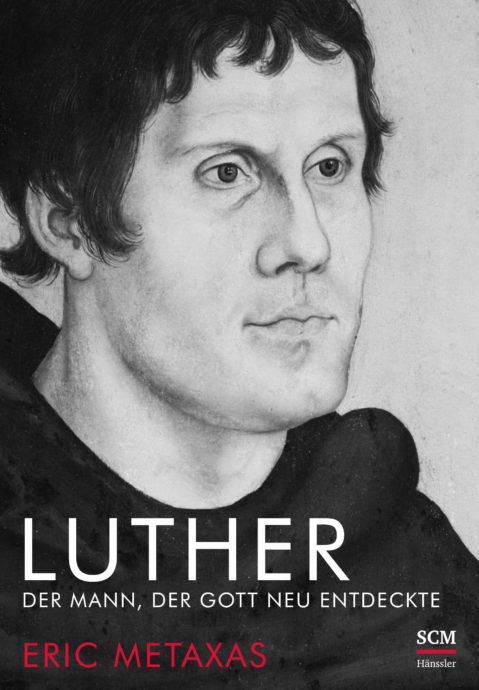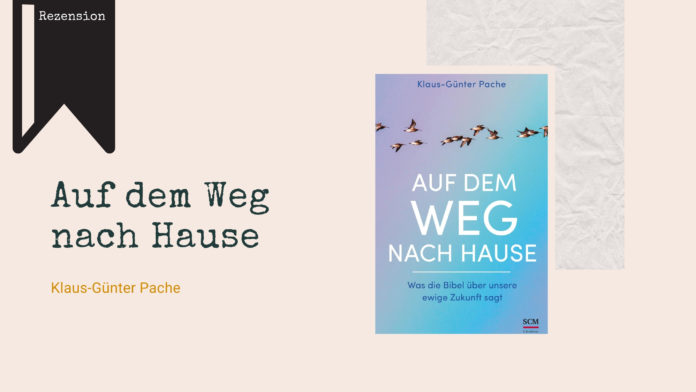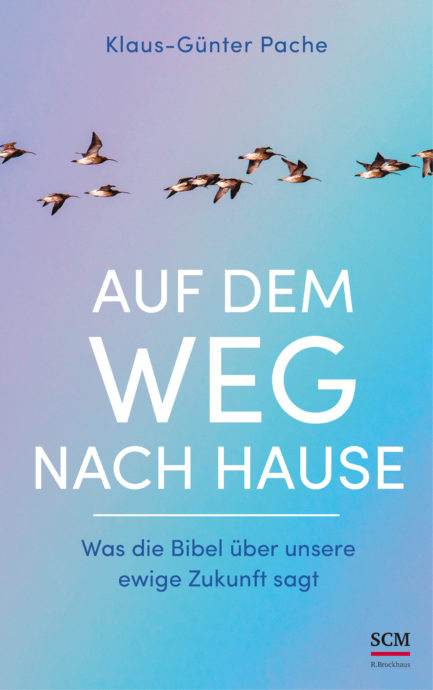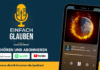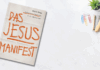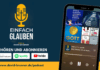Es ist das „Fest der Feste“ und das „Fest der Liebe“ – nun ja. Sagen wir mal so: Es gibt einige Irrtümer rund um Weihnachten – zehn Stück werde ich hier und heute mit diesem Artikel „entlarven“. Ach ja: Wenn du ein Humor-Attest hast, könnte dieser Artikel schwierig werden für dich – ansonsten: Viel Spaß damit!
Irrtum 1: Weihnachten ist das Fest der Liebe
So ein Quatsch! Kaum eine andere Jahreszeit und speziell besondere Tage sind so belastet mit Suizidversuchen und -leider- geglückten Suiziden. Kaum ein Fest generiert so viel Streit in den Häusern und Familien wie Weihnachten. Klar: In einer Gesellschaft, in der das Materielle im Vordergrund steht, ist es schon ein großer Grund für Streit, wenn es nur eine PS4 und keine PS5 gibt, nur ein iPhone 10 statt eines iPhone 12 oder ….Moment…kein einziges elektronisches Gerät.
Tja, wenn da dann mal die Sicherungen durchbrennen, kann man das schon gut verstehen, oder?
Nein! Tatsache ist, dass an Weihnachten so viel Unfriede herrscht wie kaum an einem anderen Tag im Jahr, der im Vorfeld so aufgebläht wird und Erwartungen so hoch gehängt werden, dass sie zum Scheitern verurteilt sind.
Irrtum 2: An Weihnachten geht’s um Geschenke
OK, Tatsache ist, dass auch in der Weihnachtsgeschichte die drei heiligen Könige (die weder drei, noch heilig, noch Könige waren, aber das ist eine andere Geschichte) Geschenke mitbrachten. Also ist es doch nicht verkehrt, sich etwas zu schenken, oder?
Richtig. Verkehrt ist es nicht. Es ist nie verkehrt, jemandem etwas zu schenken, um ihm damit eine Freude zu machen. Verkehrt ist nur und ein großer Irrtum, dass Weihnachten wegen der Geschenke ins Dasein gerufen wurde. Sicher: Wenn man so manchen Werbespot verfolgt, dann wird man diese Annahme treffen können. Sie ist aber falsch. Grottenfalsch.
Irrtum 3: Weihnachten kommt vom englischen „Whynachten“
Ja. Äh. Ne.
…für manches braucht man einfach keine lange Erklärung.
Irrtum 4: Weihnachten ist Geschichte
Natürlich ist das zweideutig. Wenn Weihnachten „Geschichte“ ist, dann ist Weihnachten Geschichte im historischen Sinn – dann wäre das nicht mal ein Irrtum, dazu aber später mehr.
Wenn du denkst, dass Weihnachten „Geschichte“ ist im Sinne von: „Es war einmal….“ – und heute hat’s keine Relevanz mehr, dann muss ich dich enttäuschen. Wenn du gut bist, dann liest du die folgenden Punkte alle auch – aber ich würde dich ansonsten bitten, zumindest noch Punkt 10 zu lesen, denn dann wirst du „eines Besseren belehrt“ – ok, belehrt werden will heute kein Mensch, ich sag’s anders: Dann wirst du merken, dass Weihnachten Geschichte im historischen Sinn ist – aber auch heute noch große Relevanz besitzt.
Irrtum 5: Weihnachten ist ein säkulares Fest
Tja, soll ich ehrlich sein? Inzwischen ist das wahrscheinlich nicht mal mehr ein Irrtum, sondern durch die Realität abgedeckt. Es geht um alles – nur nicht um den Kern von Weihnachten. Es geht um Geschenke, um Liebe, um Essen, um Familie, um Weihnachtsmärkte (selbst wenn sie ausfallen) und um Kommerz, Kommerz, Kommerz.
In Liedern wird Weihnachten besungen, in Geschichten hat Weihnachten seinen festen Platz – aber einen „religiösen Bezug“ findet man nur noch sehr, sehr selten. Tatsache ist: Weihnachten ist zu einem säkularen Fest geworden, ist es aber im ursprünglichen Sinn überhaupt nicht.
Irrtum 6: Weihnachten ist für die Familie da
Nein. Ganz einfach: nein! Was machen dann Singles? Witwer und Witwen? Gerade in diesem Jahr 2020? Und auch sonst: Welche Familie ist denn gemeint? Die unter einem Dach lebt oder doch auch die größere Familie inklusive buckliger Verwandtschaft? Und falls ja: Wieso um alles in der Welt benötige ich ein Fest, um den Wert von Familie zu erkennen?
Natürlich ist es schön, im Kreise seiner Liebsten Weihnachten zu feiern: mit Geschenken, mit Plätzchen, mit Punsch und Glühwein, weihnachtlicher Musik und vielen Kerzen. Das ist toll! Aber nicht der Grund von Weihnachten.
Irrtum 7: An Weihnachten ist Jesus auferstanden
Ja, also der Gedanke mit Jesus hat Charme. Da bist du dann immerhin schon mal auf dem richtigen Weg und ich würde sagen, wenn wir jetzt „Blinde Kuh. Weihnachtsedition“ spielen würden, dann würde ich laut rufen: „Heiß, ganz heiß!“ Man gib sich ja schon mit wenig zufriedne. Denn immerhin hast du eines erkannt: Weihnachten hat in irgendeiner Weise etwas mit Jesus zu tun.
Ich würde mal behaupten, dass du dich ab sofort als Teil einer „Minderheit“ sehen darfst – ob das ein wertvolles Prädikat ist oder nicht, darfst du selbst entscheiden, aber Fakt ist: Nur noch wenige wissen, dass Weihnachten und Jesus in irgendeiner Weise zusammengehören. Glückwunsch. Du könntest, wenn du willst, Irrtum 8 und Irrtum 9 überspringen und direkt mit Irrtum 10 fortfahren – bist aber natürlich herzlich eingeladen, auch diese beiden Irrtümer mitzunehmen.
Irrtum 8: Weihnachten ist eine Erfindung von Coca Cola
Das ist so lustig. Immer wieder begegnet mit dieser Irrtum. Klar – Coca Cola hat einen vermeintlichen Coup gelandet, denn diesem Getränkedosen wird die Erfindung des Weihnachtsmannes mit seinen schwarzen Stiefeln, dem roten Kostüm und der flauschigen Mütze zugeschrieben. Inzwischen klettert er ja nicht nur in den USA Häuserfassaden hoch, sondern auch schon in den entlegensten Ecken Deutschlands. Respekt, Coca Cola! Great deal!
Dennoch aber hat diese Firma nicht Weihnachten erfunden. Sie hat ein existierendes Fest ausgeschlachtet mit einem Marketing-Coup, der sicherlich bis heute seinesgleichen sucht.
Irrtum 9: Weihnachten ist ein nettes Märchen
„Es begab sich aber zu der Zeit….“ So beginnt die Weihnachtsgeschichte im zweiten Teil der Bibel, wie der Evangelist Lukas sie schreibt. Zugegeben: Das klingt schon ganz ähnlich wie „Es war einmal“.
Das war’s dann aber auch schon mit Märchenähnlichkeiten. Weder kommen sprechende Tiere vor noch eine Fee; weder gibt’s einen bösen König noch eine fiese Schwiegermutter.
Zu behaupten, die Weihnachtsgeschichte sei ein Märchen, ist schon ziemlich dumm. Es befinden sich in ihr jede Menge historische Anhaltspunkte, die rekonstruiert werden können – so dass jeder Mensch, der den Verstand einsetzt, erkennt: Die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen. Aber das setzt halt denken voraus – und das ist jetzt nicht so jedermanns Sache, wenn es um biblische oder christliche Themen geht. Da ballert man schnell mal gerne mit irgendwelchen Vorurteilen oder „Ich hab da mal gehört“-Argumenten um sich. Im gleichen Atemzug argumentiert man dann noch, dass der Glaube ja nur etwas für Menschen sei, die das Denken aufgegeben haben. Nun. Was soll ich sagen? Manche Menschen sind leider unbelehrbar – du hoffentlich nicht. Denn jetzt komm der alles entscheidende Irrtum:
Irrtum 10: Weihnachten hat nichts mit mir zu tun
Oh doch! „Heute ist euch der Retter geboren worden!“ (Lukas 2,11) Vielleicht der wichtigste Satz in der gesamten Weihnachtsgeschichte – die du übrigens gerne mal nachlesen kannst in Lukas 2.
„Heute ist euch der Retter geboren worden!“
Ja, Gott kommt als Baby in diese Welt – crazy! Ich kann’s dir nicht erklären – ist einfach so. Aber er kommt nicht (nur) als dieses kleine, schnuckelige Baby, sondern er kommt als Retter.
Retter. Rettung. Gar nicht so unüblich dieses Wort in unserem Sprachgebrauch: Rettung in letzter Sekunde. Bankenretter. Rettungssanitäter. Rettungswagen. Die Bergretter. Lebensretter. Smartphoneretter.
Weihnachten ist viel, viel mehr. Weihnachten ist nicht nur irgendeine Rettungsaktion – es ist der Beginn der Rettungsaktion schlechthin.
An Weihnachten kommt der in die Welt, der uns Menschen rettet.
Wozu eigentlich? Na ganz einfach: Zu einem Leben, in dem nicht ich selbst im Mittelpunkt stehen muss, sondern zu einem Leben, das geprägt ist, das widerzuspiegeln, was Gott in mich hineingelegt hat. Also ein Leben, das nicht von meiner Leistung, meiner Laune und meinem Können abhängig ist, sondern zu einem Leben, das den ehrt, der es mir geschenkt hat. Ein Leben, in dem sich Göttliches im Menschlichen entfaltet und der Mensch wieder Mensch wird. Denn ohne den Schöpfer ist das Geschöpf recht schnell erschöpft. Ein Leben also, von dem ich weiß, woher es kommt – und wohin es geht, woraufhin es zusteuert.
Er rettet uns aber nicht nur „zu etwas“ sondern auch „vor etwas“. Davor, von Gott getrennt zu sein. Sowohl hier auf der Erde (siehe oben, das „Wozu“) – aber auch nach dem Tod. Denn alle Menschen werden nach ihrem irdischen Tod auferstehen – zu einem ewigen Leben. Für die einen heißt es „Ewigkeit mit Gott“ und für andere „Ewigkeit ohne Gott“. Und ehrlich: Letzteres ist die Hölle. Das erleben wir doch hier schon. Wo wir Gott aus unserem Leben, aus unserer Gesellschaft, aus der Politik, aus dem Umgang miteinander rauslassen, da ist es nicht gut.
Insofern hat Weihnachten jede Menge zu tun – mit mir. Mit dir.
Frohe Weihnachten!