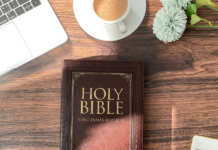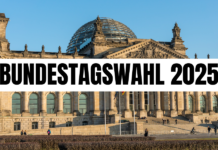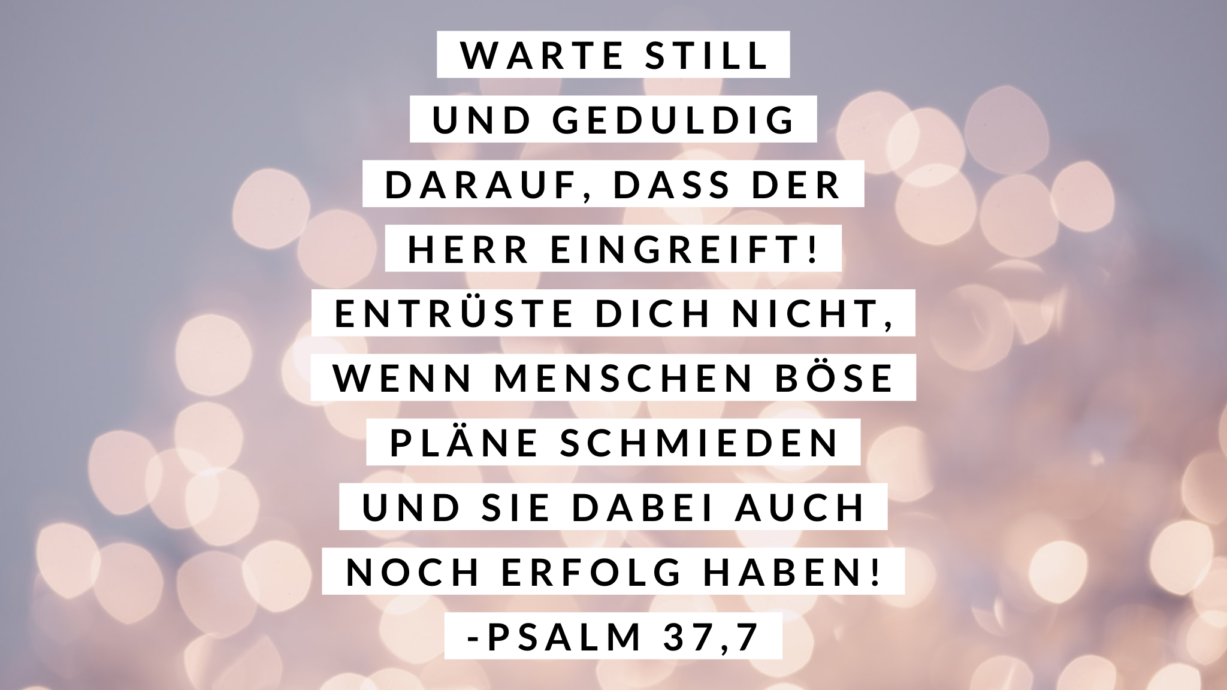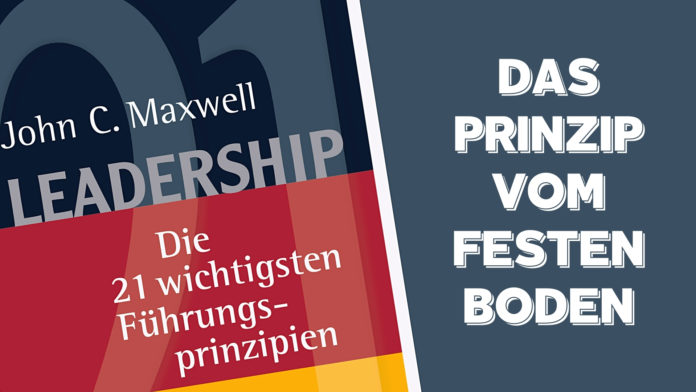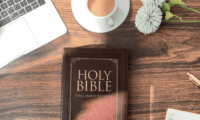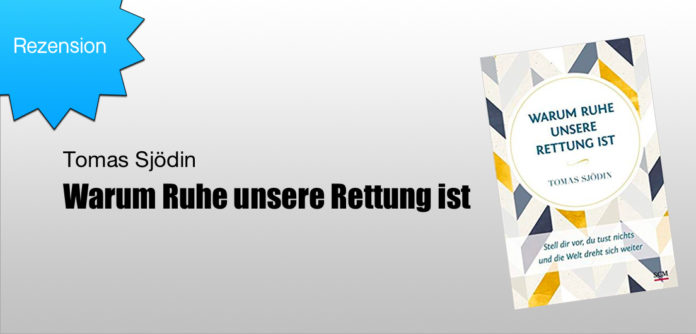Es war nicht beabsichtigt, aber ich glaube nicht an Zufälle. Insofern glaube ich vielmehr, dass Gott mich eher „beiläufig“ genau dieser Frage mal genauer nachgehen ließ. Ich war in der Vorbereitung für die Predigt „Einfluss nehmen durch Gebet“ über Daniel 9.
Es kam, wie es kommen musste: Ich machte mir Gedanken darüber, was Gebet eigentlich ist – und was Gebet nicht ist. Manche Erkenntnisse sind vielleicht etwas provokant und herausfordernd – dann ist das durchaus ein positiver Nebeneffekt.
1Beten ist kein „Weckerklingeln für Gott“
Immer mal wieder begegnet einem die Vorstellung oder Darstellung, dass wir durch Gebet „Gottes starken Arm bewegen“. Das einzig richtige an dieser Aussage ist, dass Gottes Arm „stark“ ist – so steht es auch schon in Jesaja 59:
Aber lass uns doch mal anschauen, was es bedeuten würde, wenn wir durch unser Gebet Gottes Arm bewegen würden. Wenn dem so wäre, dann könnte man leicht schlussfolgern: Ohne unser Gebet bewegt Gott seinen Arm nicht. Ohne unser Gebet tut Gott nichts – unser Gebet ist sozusagen das „Weckerklingeln für Gott“.
Das wiederum bedeutet, dass Gott eigentlich tatenlos zuschaut, was auf der Erde so geschieht und erst eingreifen kann, wenn Christen anfangen, zu ihm zu beten. Aber – wann greift er dann ein? Wie viel Gebet ist nötig? Wie viele Vaterunser, wie viel Sprachengebet, wie viele Gebetsstunden, wie viele Gebetsversammlungen und vor allem ganz wichtig: Müssen Landeskirchlicher, Baptisten, Charismatiker und Pfingstler gleich viel beten oder die einen mehr als die anderen?
So witzig das klingt: Leider ist genau damit in der Kirchengeschichte immer wieder eine Menge Unheil angerichtet worden.
Menschen fragen: „Wieso tut Gott nichts? Wieso greift er nicht ein?“
Menschen antworten: „Du hast zu wenig gebetet! Du musst mehr beten!“
Und schon ist die Schuld bei mir – so ein Quatsch! Aber diese Theologie hat viel Schaden angerichtet im Glauben, im Leben, in der Seele von einzelnen Menschen. Irgendwann begannen sie wirklich zu glauben, dass es an ihnen liegen würde, ob und wie Gott eingreift und wenn er es nicht tut – dann beten sie halt zu wenig. Ich finde das tragisch und verantwortungslos. Da ist jemand schwer krank und betet, was das Zeug hält – und es tritt keine Heilung ein. Und nun? Wenn du der Ansicht bist, dass wir durch Gebet Gottes Arm bewegen, den er sonst nicht bewegt hätte, wird es seelsorgerlich äußerst herausfordernd bis unlösbar.
Darüber hinaus gibt es für mich so etwas wie eine „geistliche Logik“, das heißt: Der christliche Glaube ist nicht nach menschlicher, aber nach göttlicher Logik aufeinander aufbauend und widerspricht sich nicht – vielmehr legt sich die Bibel beispielsweise gegenseitig aus. So auch im Blick auf das Gebet. Jesus lehrt seine Jünger das Vaterunser. Bevor er das tut, sagt er einen – wie ich finde – herausragenden Satz über das Beten:
Wenn dem so ist – und ich glaube, dass dem so ist – wäre es geistlich gesehen vollkommen unerklärlich, wieso Gott erst durch unser Gebet bewegt werden müsste, wenn er doch ohnehin schon längst weiß, was wir benötigen.
Dann wäre Gott wirklich dieser G.O.T.T., für den ihn manche halten: Guter Opa, total taub. Und das wäre sogar noch nett ausgedrückt, denn eigentlich wäre Gott dann nichts anderes als ein unberechenbares, willkürliches und menschenverachtendes Wesen, das ohnehin macht, was es will – denn es weiß zwar, was der Mensch braucht – aber er säße wie eine beleidigte Leberwurst in seinem überdimensionalen Schaukelstuhl, nur darauf wartend, dass das kleine Häufchen Menschlein nun endlich auch mal in die Puschen kommt und zu ihm schleicht, um Dinge zu sagen, die er ohnehin längst schon weiß, schon längst darauf hätte reagieren können, aber nein: sein Arm war zu schwach. Crazy. Abgefahren. Komisch. Gefährlich. Das hat mit Beten nichts zu tun.
Bevor ich mich dem widme, was Beten wirklich ist, noch eine Sache, was Beten nicht ist.
2Beten ist keine Verhandlungssache
Ich glaube, dass Gott durch und durch gut ist. Ich glaube, dass er das unabhängig von unseren Gedanken, Gefühlen und auch Empfindungen ihm gegenüber ist. In der Bibel wird das einmal so beschrieben:
Wenn wir nun also beten, dann wenden wir uns an diesen Gott, der für Christen wie ein Vater ist, bei dem es kein „heute so, morgen so“ gibt. Er ist immer gut, bei ihm ist Licht immer Licht und Dunkel immer Dunkel. Es gibt keine unberechenbare Aktionen, keine Launen, keine Unwägbarkeiten. Gott ist gut. Punkt!
Weil Gott gut ist, schuldet er uns nichts, denn sonst wäre er nicht gut. Wenn ein Mensch einem anderen Menschen etwas schuldet, dann nur deswegen, weil er an einer bestimmten Stelle nicht „gut gehandelt“ hat. Er schuldet jemandem Aufmerksamkeit, weil er abgelenkt ist. X schuldet Y zehn Euro, weil er sie von Y geliehen hat. Y schuldet X einen Kasten Bier, weil X die Wette gewonnen hat. Whatever: Wenn jemand einem anderen etwas schuldig ist, dann deswegen, weil sein Verhalten in irgendeiner Weise defizitär war und ist.
Aber nicht so bei Gott. Gott ist gut. Durch und durch. Nicht nur manchmal, sondern jeden Tag:
Ich darf alles von Gott erbitten (dazu mehr im letzten Punkt) – wichtig ist nur, dass ich nicht die Haltung an den Tag lege, als ob Gott mir das schuldig sei. Nein – das ist er nicht. Gott ist mir gar nichts schuldig. Aber er gibt gerne, freiwillig, großzügig – weil er mich liebt. Das ist das Faszinierende und Besondere an Gottes Wesen und seinem Verhältnis uns Menschen gegenüber. Der Mensch ist es, der Gott etwas schuldig ist, nicht andersrum – aber Gott ist derjenige, der dem Menschen gerne, großzügig und freiwillig gibt – und nicht andersrum.
3Beten ist Atemholen für die Seele
Stell dir vor, du triffst eines Tages einen Menschen, der dir sagt: „Ich hab die Schnauze voll! Jeden einzelnen Tag meines Lebens habe ich geatmet. Eingeatmet, ausgeatmet, eingeatmet, ausgeatmet….Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich lass das mit dem Atmen.“
Wenn dir der Mensch wichtig ist, bestellst du sofort einen Rettungswagen, falls er seine Ankündigung wahrmachen sollte. Abgesehen davon ist das natürlich totaler Quatsch, was dein Gegenüber dir da so erzählt. Es gibt aber eine erstaunliche Parallele zum Gebet.
Ich liebe dieses Wort von John Henry Newman, einem Theologen des 19. Jahrhunderts. Es bringt auf ganz einfache Weise auf den Punkt, um was es beim Gebet geht: um eine überlebenswichtige Angelegenheit für unsere Seele. Jetzt kann hier keine lange Ausarbeitung erfolgen, was „die Seele“ ist – für mich ist es der „innere Mensch“, mein inneres Wesen, mein „inwendiger Mensch“ (wie Luther es übersetzt), von dem Paulus schreibt:
Gebet ist überlebenswichtig für meinen inneren Menschen, für meine „verborgene Welt“, wie es Gordon MacDonald in seinem Buch „Ordne dein Leben“ beschreibt. [Einiges mehr zu diesem Buch und dem Begriff der „verborgenen Welt“ als Bezeichnung für diesen inneren Menschen bzw. für die Seele, findest du im Artikel „Ordne dein Leben„].
Wenn Christen beten, dann ist es in erster Linie das Aufrechterhalten der geistlichen Vitalfunktion und Ausüben dessen, was ganz natürlich zum Wesen eines Christen gehört. Erst in zweiter, dritter, vierter Reihe ist es ein Bitten, Danken, Klagen.
Beten – und ich beziehe mich hier vor allem auf das gesprochene Gebet mit Worten (es gibt viele Arten zu beten) – ist sozusagen Selbst-Seelsorge. Und wer betet, der weiß: Es funktioniert! Das klingt nach einer Milchmädchen- und Kaffeeautomaten-Rechnung, aber es ist nun mal so: Im Gebet werde ich innerlich justiert. Ich erkenne, wer ich bin und wer Gott ist – und dass das nicht ein und dieselbe Person ist. Und das ist gut so. Mir wird bewusst, wer ich vor Gott bin: Geschöpf – und zwar unendlich geliebtes Geschöpf.
Und als dieses unendlich geliebtes Geschöpf lässt Gott mir nun im Gebet etwas zuteil werden, was unser menschliches Denken so weit übersteigt, dass es wohl schwierig werden wird, es mit menschlichen Worten zu beschreiben – aber andere Worte stehen mir leider nicht zur Verfügung.
4Beten ist Mitkämpfen an Gottes Seite
Wenn Christen beten, stellen sie sich an Gottes Seite und werden von ihm mit hinein genommen in den Kampf gegen alles Wider-Göttliche in dieser Welt. Das beginnt beim ganz Persönlichen und hört beim politischen Weltgeschehen nicht auf. Gott ist weder Verhandlungspartner noch irgendetwas schuldig. Aber er verleiht dem Menschen eine unglaublich großartige Ehre und Würde, indem er ihn an seine Seite nimmt und mit ihm für diese Welt kämpft.
Im Gebet sprechen Christen die Wahrheit aus und proklamieren Gottes Größe und Herrlichkeit mitten hinein in die Widrigkeiten und unsäglichen Ereignisse dieser Welt – persönlich wie global. Ob persönliche Schuld, Krankheit, finanzielle Notsituation, zwischenmenschliche Konflikte, herausfordernde Situationen im Berufsleben, politische Entscheidungen in kommunaler, regionaler, das ganze Land und die ganze Welt betreffende Ebene sowie Entwicklungen weltweit, die sich direktem menschlichen Einfluss wohl entziehen – in alledem tut der Christ eines: Er kapituliert nicht vor diesen Dingen sondern streitet mit Gott an seiner Seite für diese Dinge.
Selbst dort, wo wir nur noch bitten, klagen und jammern – selbst dort tun wir es an Gottes Seite. Wir tun es an der Seite dessen, der Himmel und Erde, Sonne, Mond und Sterne, die Galaxien und das ganze Universum erschaffen hat. An der Seite dessen, der von Ewigkeit her war und der bis in alle Ewigkeit sein wird.
Für mein menschliches Denken ist das ein bisschen zu viel. Dass dieser Gott mir diese besondere Ehre zuteil werden lässt und mich mit an seine Seite nimmt – das ist schon sehr abgefahren! Aber es ist so – ich kann’s nicht ändern – und will es auch gar nicht ändern. Nur tut es gut, wenn wir uns dessen immer mal wieder bewusst werden, dass Beten weit, weit mehr ist, als einfach nur ein paar Worte daherzustammeln, sondern ein Aussprechen (Proklamieren), dass Gott Sieger ist, dass er Herr über alles ist, dass niemand und nichts ihm gleich kommt und dass wir noch so viel zweifeln können – Gott ist immer noch größer.
Denn vielleicht kommt dir so ein bisschen der Gedanke, dass das ganze ja schon ’ne Nummer ist – ja das ist es. Und du brauchst keine Sorgen haben, dass du zu klein dafür wärst oder dass deine dich anklagenden Gedanken und Gefühle Gott in irgendeiner Weise negativ beeindrucken könnten.
Und deswegen können und sollen wir Gott im Gebet alles sagen.
5Beten ist: Gott alles sagen
…und zwar schonungslos. Es gibt Aussagen in den Psalmen (Gebete des ersten Teils der Bibel), die haben nur deswegen noch nicht für großen Aufruhr gesorgt, da sie in den Übersetzungen immer so „lieb und nett“ klingen. Aber da werfen Menschen Gott Dinge an den Kopf – da bleibt dir die Spucke weg. Gott hält das aber aus! Er hat nicht gekündigt! Im Gegenteil: er erfreut sich größter Gesundheit und Lebendigkeit!
Weil Beten Atemholen und Kämpfen zugleich bedeutet, können, sollen, müssen, dürfen wir Gott unbedingt alles sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Es gibt keine Tabus!
Da steckt alles drin: Danken, Bitten bis hin zum Flehen – und alle Anliegen. Alles. Meinen Kindern sage ich immer und immer wieder: „Ihr dürft mir alles sagen und mich um alles bitten!“ Das wissen sie. Und sie kennen mich inzwischen schon so gut, dass sie das auch tun – auch wenn sie manchmal den Vorschub bringen: „Papa, ich weiß, dass ich das wahrscheinlich nicht darf, aber….“ Dann bin ich besonders gespannt – und vor allem bin ich besonders dankbar – warum? Weil meine Kids es gecheckt haben, was wir bei Gott scheinbar irgendwie nicht so ganz verstehen, verstehen wollen oder verlernt haben: Ihm alles (A L L E S) zu sagen. Nirgends in der Bibel sagt Gott: „Ihr dürft immer zu mir kommen und mir alles sagen: Außer ________________ (setze in die Lücke das ein, was dir grad spontan in den Sinn kommt)!“ Es steht nicht in der Bibel – also sag es ihm!
Denn der Umkehrschluss von wegen „Gott weiß doch eh schon alles, wieso soll ich es ihm sagen?“ ist unsinnig – weil Gebet kein Weckerklingeln für Gott ist sondern ein Mitkämpfen und Atemholen. Insofern hat alles seinen Platz im Gebet.
Wenn Beten Atemholen der Seele ist, wenn Beten ein Mitkämpfen an Gottes Seite ist und wenn Beten bedeutet, dass wir Gott alles sagen dürfen, dann macht uns das „eins mit Gott„. Etwas, das die Mystiker ganz besonders wichtig finden (und leider manchmal auf der anderen Seite vom Pferd dann runterfallen), aber was in meinen Augen absolut wichtig und genauso unbeschreiblich ist, wie die Tatsache, dass der Schöpfer dieses Universums sich freiwillig und großzügig uns Menschen an seine Seite holt.
Wir bilden mit Gott eine Einheit, wir sind so eng mit ihm verbunden, wie Jesus es seinen Jüngern schon mit auf den Weg gegeben hat: